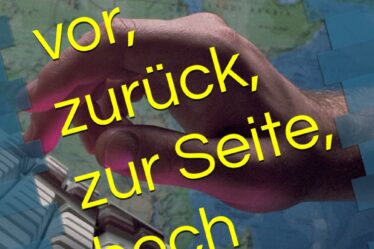Das erweiterte Gesetz der Zeit (Dr. Wolf Barth)
Basis-Information: Das Gesetz der Zeit
Theoretischer Rahmen: Die vier Zeitfrequenzen
Das erweiterte „Gesetz der Zeit“ umfasst vier Frequenzebenen:
1. Biologische Zeit (ca. 25 Jahre): Konstante Frequenz der Generationenfolge, Generationswechsel, physische Reproduktion
2. Soziale Zeit: Gesellschaftliche Strukturveränderungen bzw, Umstrukturierung, kultureller Wandel
3. Technologische Zeit: Entwicklung materieller Produktionsmittel und Lebensbedingungen, Innovation und technische Transformation
4. Geistige Zeit/Bewusstsein: Entwicklung von Weltbildern, Werten, Selbstreflexion, Bewusstseinsentwicklung, Ideologie, Weltanschauung und Erkenntnisprozesse
Analyse der Frequenzebenen im „Gesetz der Zeit“
Der Text „Das Gesetz der Zeit“ postuliert, dass alles im Universum als Schwingungsprozess beschrieben werden kann und dass Zeit das In-Beziehung-Setzen der Frequenzen dieser Prozesse ist, wobei eine als Referenz dient
1) Biologische Zeit ():
Definition: Dies ist die Frequenz, die mit dem Informationsaustausch auf biologischer Ebene durch den Generationswechsel verbunden ist.
Charakteristik: Sie ist im gesamten globalen historischen Prozess nahezu unverändert und konstant geblieben3. Der Text gibt eine Periodizität von etwa 25 Jahren an, basierend auf dem produktivsten Lebensabschnitt des Menschen (25-50 Jahre) und dem Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt des ersten Kindes (20-25 Jahre).
Implikation: Die biologische Zeit repräsentiert die natürliche, inherente Geschwindigkeit der menschlichen Reproduktion und des biologischen Informationsaustauschs.
2) Soziale Zeit ():
Definition: Dies ist die Änderungsrate von Information auf extragenetischer Ebene, d.h., sie umfasst alle nicht genetisch bedingten kulturellen Informationen und gesellschaftlichen Umstrukturierungen5.
Charakteristik: Die Frequenz der sozialen Zeit nimmt ständig zu6. Der Text beschreibt, wie die Einstellung der Menschen zu ihrer Umgebung sich ändert und nach der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Wechsel der Logik des menschlichen Sozialverhaltens stattfindet777. Früher waren grundlegende Informationen (wie „es gibt Gott, König und Kirche“) bis zum Tod eines Menschen unerschütterlich; heute ist die Zeit der Einweihungen vorbei und sie haben durch die steigende Frequenz der sozialen Zeit jegliche Bedeutung verloren8888. Um sich anzupassen, muss der Mensch heute ununterbrochen neues Wissen erwerben und selbstständig lernen9.
Implikation: Die soziale Zeit beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich Gesellschaften und Kulturen aufgrund von Wissen und Information verändern.
3) Technologische Zeit:
- Definition: Dies ist die Änderungsrate der Technosphäre, also der materiellen Produktionsmittel und Lebensbedingungen10.
- Charakteristik: Die Änderungsrate der Technologie nimmt ständig und besonders stark zu11. Während sie anfangs in Jahrtausenden gemessen wurde (Wagen über Tausende von Jahren 12), wird sie heute in Jahren gemessen (Autos, Flugzeuge: Modernisierung praktisch jedes Jahr 13). Die Beschleunigung wird durch einen „legalisierten Wucherzinssatz“ angeheizt, der eine permanente Einführung neuer Technologien zur Rückzahlung von Schulden erforderlich macht14.
- Implikation: Die technologische Zeit repräsentiert die Geschwindigkeit der materiellen und technischen Innovation.
4) Geistige Zeit/Bewusstsein:
- Definition: Entwicklung von Weltbildern, Werten, Selbstreflexion, Bewusstseinsentwicklung, Ideologie, Weltanschauung und Erkenntnisprozessen.
- Charakteristik: Obwohl nicht explizit mit einem eigenen Frequenzsymbol im Text versehen, wird die „geistige“ oder „Bewusstseins“-Ebene durch die Beschreibung der „Logik des menschlichen Sozialverhaltens“ und der Notwendigkeit der ständigen Wissensaneignung zur Anpassung an die sich schnell ändernde soziale Zeit impliziert. Der Text fordert dazu auf, sich selbstständig Wissen anzueignen und eine Methode dafür zu entwickeln15.
- Implikation: Diese Ebene bezieht sich auf die Geschwindigkeit, mit der sich das kollektive und individuelle Bewusstsein, die Werte und das Weltbild einer Gesellschaft entwickeln oder anpassen.
Das „Gesetz der Zeit“ – Das Verhältnis der Frequenzen
Der Text führt das „Gesetz der Zeit“ ein als das Verhältnis der Frequenzen zwischen biologischer und sozialer Zeit und ihre Wechselbeziehung im globalen historischen Prozess16.
- „Herrschaft der Tiere“ (): Dies ist die früheste Phase, in der die biologische Zeit die soziale Zeit übersteigt1717171717. Änderungen in der Gesellschaft vollziehen sich sehr langsam im Vergleich zur Generationsfolge. Die Wissenspyramide (mit Monopol des Wissens an der Spitze und abnehmendem Wissen zur Basis hin 18) ist stabil, da wenig neues Wissen entsteht, das Monopol der „Sklavenhalter“ auf Wissen leicht aufrechterhalten werden kann.
- Resonanz (): In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (1900-1950) kam es zu einer qualitativen Veränderung, bei der die Frequenzen der biologischen und sozialen Zeit einander annähern oder gleich werden1919191919191919. Dies wird als „Resonanz“ bezeichnet, ein Phänomen, das in technischen Systemen zu irreversiblen Zerstörungen führen kann (Beispiele: Brückeneinstürze)20202020. Diese Phase war von einer Welle von Kriegen und Revolutionen (als „Apokalypse“ in der Bibel bezeichnet 21) geprägt, die die Menschheit nur überlebte, weil die Zeitspanne kurz und die Weltbevölkerung nicht kritisch groß war22.
- „Herrschaft des Menschen“ (): Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts übersteigt die Frequenz der sozialen Zeit die der biologischen Zeit232323232323232323. Dies bedeutet, dass Veränderungen im Informationsstatus der Gesellschaft innerhalb einer Lebenszeit oder Generation sehr schnell stattfinden24. Das Wissen „rieselt“ nach unten, und die Wissenspyramide beginnt zu „schmelzen wie Eis“25. Die „Sklavenhalter“ müssen den „Sklaven“ (Arbeitern) ständig neues Wissen bereitstellen, um „Profit“ zu erzielen, was paradoxerweise dazu führt, dass sich die Sklaven durch mehr Wissen befreien26. Der Spruch „Wer die Information beherrscht – der beherrscht die Welt“ 27und „Wissen ist Macht“ 28wird durch das Gesetz der Zeit umgewandelt: Das Monopol auf Wissen bricht zusammen29.
Fazit: Das vierdimensionale Frequenzmodell als Analysegrundlage
Basierend auf dem erweiterten Gesetz der Zeit mit seinen vier Frequenzarten können wir die historische Entwicklung der sozialistischen Gesellschaften in UdSSR und DDR tiefgehender verstehen
Abgrenzung: „Historische Zeit“ vs. „Soziale Zeit“
Die von Ihnen zusätzlich genannten Begriffe stammen aus zwei unterschiedlichen konzeptuellen Rahmenwerken, die zwar Berührungspunkte haben, aber nicht identisch sind:
- Soziale Zeit () (aus dem Anhang „Das Gesetz der Zeit“):
- Dies ist, wie oben definiert, die Änderungsrate der Information auf extragenetischer Ebene30. Sie beschreibt die Geschwindigkeit, mit der sich Kultur (als nicht-genetisch bedingte Information) und gesellschaftliche Strukturen verändern.
- Der Fokus liegt auf der Geschwindigkeit des Wandels von Wissen, Kultur und Stereotypen innerhalb einer Gesellschaft.
- Historische Zeit (nach Grigori Ioffe und der Strauss-Howe-Generationentheorie):
- Dies bezieht sich auf wiederkehrende Zyklen sozialer und politischer Transformation in der Geschichte. Die Strauss-Howe-Theorie beschreibt vier spezifische Phasen (Wenden): The High, Das Erwachen, Die Auflösung, Die Krise. Diese Phasen sind qualitative Beschreibungen von Zeitabschnitten, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken.
- Der Fokus liegt hier auf makrohistorischen, oft generationellen Zyklen und deren prägenden sozio-politischen und kulturellen Merkmalen. Es geht um die Charakterisierung ganzer Epochen und nicht primär um die „Rate des Informationswandels“ im Sinne einer Frequenz.
Ist „historische Zeit“ etwas anderes als „soziale Zeit“?
Ja, sie sind unterschiedlich, aber eng miteinander verbunden.
- Die soziale Zeit () ist ein quantitatives Maß für die Geschwindigkeit, mit der sich kulturelle und gesellschaftliche Informationen ändern. Es ist eine Frequenz.
- Die historische Zeit (im Kontext der Strauss-Howe-Theorie) beschreibt qualitative, zyklische Phasen der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie gibt Inhalt und Charakter der Zeiträume an und postuliert ein Muster des historischen Verlaufs.
Man könnte argumentieren, dass die Frequenz der sozialen Zeit () sich im Laufe der verschiedenen Phasen der „historischen Zeit“ (z.B. Strauss-Howe-Zyklen) unterschiedlich verhält. Zum Beispiel könnte die in einer „Krise“-Phase höher sein als in einer „High“-Phase, da die „Krise“ durch schnelle und disruptive Veränderungen gekennzeichnet ist.
Die „historische Zeit“ liefert den Rahmen und die Charakterisierung der Epochen, während die „soziale Zeit“ ein spezifisches Maß für die Geschwindigkeit des Informationswandels innerhalb oder zwischen diesen Epochen darstellt. Die soziale Zeit als Frequenz ist ein Werkzeug zur Analyse der Dynamik innerhalb der breiteren Muster der historischen Zeit.
Anwendung des Konzeptes der historischen Zeit (nach der Strauss-Howe-Generationentheorie) auf die Geschichte der UdSSR und der DDR.
Es ist wichtig zu beachten, dass diese Theorie ursprünglich auf die amerikanische Geschichte zugeschnitten ist und eine direkte Übertragung auf andere Gesellschaften eine Interpretation und Anpassung erfordert, die im Kontext der spezifischen historischen und politischen Gegebenheiten erfolgt.
Anwendung der Strauss-Howe-Phasen auf die UdSSR:
Die Geschichte der Sowjetunion (UdSSR) war von spezifischen internen Dynamiken geprägt, die sich von den USA unterscheiden, aber dennoch lassen sich Parallelen zu den Phasen finden:
- The High (Hochphase):
- UdSSR-Analogon (ca. Ende der 1940er bis Mitte der 1960er Jahre): Diese Phase könnte mit der Nachkriegsstalinismus- und frühen Chruschtschow-Ära korrespondieren. Nach dem Großen Vaterländischen Krieg gab es eine Periode des Wiederaufbaus und der Konsolidierung der Macht der KPdSU. Trotz des repressiven Charakters des Regimes herrschte ein Gefühl des nationalen Zusammenhalts (im Kampf gegen den äußeren Feind und für den Aufbau des Sozialismus), starker Institutionen (Partei, Staat) und eines gewissen Optimismus bezüglich des sowjetischen Projekts (Wettrüsten, Raumfahrt, Wirtschaftswachstum). Die Ideologie war fest verankert, und Abweichungen wurden stark unterdrückt.
- Das Erwachen (Awakening):
- UdSSR-Analogon (ca. Mitte der 1960er bis Ende der 1970er Jahre): Dies könnte die Breschnew-Ära umfassen. Obwohl es keine offene Gegenkultur im westlichen Sinne gab, setzte eine gewisse Stagnation im Inneren ein (oft als „Ära der Stagnation“ bezeichnet). Gleichzeitig gab es eine Zunahme des Individualismus, versteckte Dissidenzbewegungen und ein Hinterfragen der offiziellen Ideologie (z.B. Samisdat-Literatur). Der Glaube an die kollektiven Ideale der Revolution begann zu erodieren, und es gab eine Verschiebung hin zu persönlicher (wenn auch oft unterdrückter) spiritueller oder intellektueller Erkundung. Das Wirtschaftswachstum verlangsamte sich, und die soziale Mobilität stagnierte.
- Die Auflösung (Unraveling):
- UdSSR-Analogon (ca. 1980er Jahre bis 1991): Diese Phase entspricht der Gorbatschow-Ära mit Glasnost und Perestroika. Es war eine Zeit des Niedergangs der sozialen Solidarität und der politischen Fragmentierung. Die Ideologie verlor ihre Bindekraft vollständig, der Materialismus (oft in Form von Schwarzmärkten und Mangelwirtschaft) trat offen zutage, und die Kontrolle des Staates über das Individuum und die Gesellschaft begann sich aufzulösen. Nationale Bewegungen und Forderungen nach Autonomie und Unabhängigkeit nahmen zu. Das System zerfiel schrittweise.
- Die Krise (Crisis):
- UdSSR-Analogon (ab 1991 und die Jahre danach): Diese Phase beginnt mit dem Zerfall der UdSSR und dem Übergang zu einer neuen politischen und wirtschaftlichen Ordnung. Es war eine Zeit großer Unruhen, Instabilität und radikaler Umbrüche. Wirtschaftskrisen, soziale Verwerfungen, Kriege (z.B. in Tschetschenien) und der Aufbau neuer politischer Systeme kennzeichneten diese Periode. Es war eine Zeit, in der alte Sicherheiten verschwanden und neue Konflikte entstanden.
Anwendung der Strauss-Howe-Phasen auf die DDR:
Die Geschichte der DDR ist kürzer und enger mit der UdSSR verbunden, aber auch hier lassen sich die Phasen in Analogie interpretieren:
1, The High (Hochphase):
DDR-Analogon (ca. Ende der 1940er bis Anfang der 1960er Jahre): Diese Periode umfasst die Gründungsphase und den Aufbau des Sozialismus. Es war eine Zeit, in der das System konsolidiert wurde, Institutionen aufgebaut und die Ideologie verankert wurden. Trotz des repressiven Charakters (z.B. Volksaufstand 1953) gab es einen starken Glauben an den Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft und eine gewisse kollektive Mobilisierung, oft auch unter Druck.
2. Das Erwachen (Awakening):
DDR-Analogon (ca. 1960er bis Ende der 1970er Jahre): In dieser Phase, oft als „Ära der Stabilität“ unter Honecker bezeichnet, gab es eine gewisse Lockerung im Vergleich zu den frühen Jahren, aber auch ein wachsender Individualismus und die Entstehung von Nischenkulturen. Die offizielle Ideologie wurde zunehmend als hohl empfunden. Kulturelle Bewegungen und Dissidenz, wenn auch im Verborgenen, nahmen zu. Es war eine Zeit, in der sich Menschen zunehmend von den kollektiven Zielen abwandten und eigene Wege suchten, auch wenn diese eingeschränkt waren.
3. Die Auflösung (Unraveling):
DDR-Analogon (1980er Jahre bis Herbst 1989): Dies war die Phase des allmählichen Niedergangs der sozialen Solidarität und der politischen Fragmentierung. Die Wirtschaftsleistung stagnierte, die ideologische Kontrolle nahm ab, und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wuchs. Das Gefühl des Materialismus (oder des Mangels daran) und die zunehmende Isolation von der westlichen Welt führten zu einer Erosion des Systems. Der Text über Volker Brauns „Der Wendehals“ beschreibt diese Zeit als ein Scheitern des großen Entwurfs und der Entwertung der Errungenschaften der bundesrepublikanischen Einheit.
4. Die Krise (Crisis):
DDR-Analogon (Herbst 1989 bis zur Wiedervereinigung 1990 und die unmittelbare Nachwendezeit): Dies ist die Phase der radikalen Umbrüche, der Wende und der Wiedervereinigung. Es war eine Zeit großer
Unruhen, Unsicherheiten und des Zusammenbruchs alter Strukturen.
Für viele Bürger der ehemaligen DDR bedeutete dies einen Verlust der sozialen und geistigen Existenzgrundlage, wie es z.B.in Volker Brauns „Der Wendehals“ durch die Charaktere Ich und Er dargestellt wird. Die Ideale des Sozialismus waren enttäuscht, und das neue System brachte eigene Herausforderungen und Brüche mit sich, einschließlich der Macht der Korruption und des Konsums.