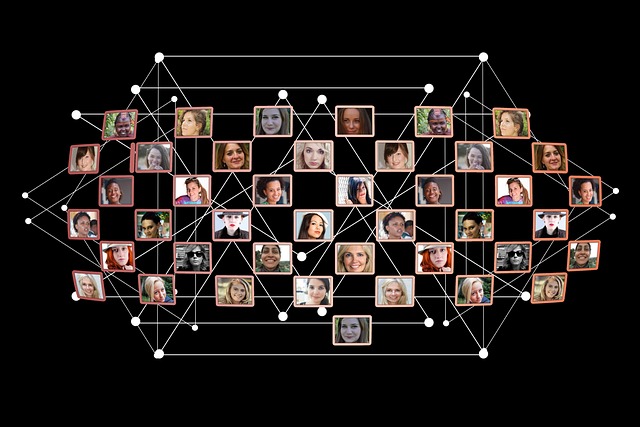
Kooperation oder Konkurrenz?
Ich studierte und erforschte die Seele und den Geist des Menschen (Psychologie).
Durch die materialistische Wissenschaft (sowohl bürgerliche als auch marxistische) kann jedoch das Wesen und das Wesentliche des „Psychischen“ jedoch nicht erkannt werden.
Ich spezialisierte mich auf das Erleben und Verhalten von Menschen in sozialen Situationen in der Teildisziplin „Sozial-Psychologie“.
Psychische Tätigkeit wurde als „Widerspiegelungsfunktion“ zur Regulierung des sozialen Verhaltens verstanden und erforscht.
Als Kriterium für die praktische Optimierung sozialen Verhaltens mit sozialpsychologischen Methoden wurden die kooperativen Leistungsvorteile von Gruppen angenommen.
• Kontakt und Interaktion in Klein-Gruppen (Aristoteles: „Der Mensch ist von Natur aus ein Gemeinschaftswesen“)
• Kommunikation (Paul Watzlawick: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“)
• Kooperation mit anderen (zum Überleben, für die persönliche Entwicklung und für den Fortschritt der Gesellschaft und Kultur)
1) Kooperation als Überlebensstrategie
Menschliche Gemeinschaften funktionieren als strategische Organismen (Karin Bruckner, 2023) auf einer supraorganismischen Ebene, ähnlich wie ein Ameisenstaat oder ein Bienenvolk. Die Individuen sind zwar autonom, aber ihr Verhalten ist koordiniert, um das Überleben und das Wohl der übergeordneten Einheit zu sichern. Kooperation ist dabei
• ein wesentliches Element der menschlichen Natur und
• ein entscheidender Faktor für das Überleben und den Fortschritt der Gesellschaft.
(1) Überleben und Entwicklung
Menschen sind auf Gruppen angewiesen, um arbeitsteilig zu bauen, Nahrung anzubauen, zu ernten oder zu jagen, sich zu schützen und zu verteidigen, den Nachwuchs großzuziehen und zu erziehen. Soziale Beziehungen und Bindungen, Interaktionen und Gemeinschaften sind für die menschliche Existenz ebenso wichtig wie grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung und Wasser.
(2) Identität und Wohlbefinden
Die eigene Identität entwickelt sich erst im Austausch mit anderen. Wir lernen, wer wir sind, indem wir uns in sozialen Rollen und Beziehungen erfassen und identifizieren. Das Gefühl der Zugehörigkeit, von Freundschaft und Liebe sowie Zusammenarbeit sind grundlegende menschliche Bedürfnisse, die zum psychischen und emotionalen Wohlbefinden beitragen. Einsamkeit und soziale Isolation können schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben.
(3) Kultur und Fortschritt
Kooperation ist die Grundlage für die Weitergabe von Sprache, Wissen, Traditionen und Werten von einer Generation zur nächsten. Kultureller, wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt sind ohne den sozialen Austausch und die Zusammenarbeit undenkbar. Der Mensch ist von seiner Natur aus ein Gemeinschaftswesen. Außerhalb der Gemeinschaft ist er entweder ein Tier oder ein Gott.
2) Menschen sind „strategische Organismen“ (Karin Bruckner, 2023),
da sie als bio-psycho-soziale Organismen über Mechanismen für Kooperation verfügen und die sinnvolle Funktion von Kooperation auf einer supraorganismischer Ebene erkennen und nutzen.
Eine „supraorganismische Ebene“ geht in Gemeinschaften und Ökosysteme über den individuellen Organismus hinaus. Diese Ebene umfasst das Zusammenspiel und die Organisation von Organismen, die als übergeordnete Einheit agieren, wie zum Beispiel ein Ameisenstaat, ein Bienenvolk oder die gesamte Biosphäre der Erde. In diesen komplexen Systemen sind die einzelnen Individuen zwar autonom, aber ihr Verhalten ist auf eine Weise koordiniert, dass die gesamte Gemeinschaft als ein funktionierender Superorganismus betrachtet werden kann.
3) Kooperation als Basis-Funktion menschlicher Gemeinschaft
Kooperation ist nicht nur eine (soziale) Handlung, sondern eine grundlegende Funktion, die menschliche Gemeinschaften als „strategische Organismen“ definiert und ihnen ermöglicht, zu existieren, sich zu entwickeln und zu überleben.
4) Sprachliche Sensibilisierung und Nutzung
(1) Uneinheitlicher und unklarer Sprachgebrauch verstärkt die Widersprüche (Paradoxien) und Probleme der Kooperation in der menschlichen Gesellschaft.
Eine Auflösung ist auf konzeptioneller Ebene erforderlich.
(2) Widersprüche, sachliche Probleme und soziale Konflikte werden umgangen, indem Kooperation als natürliche und wesentliche Funktion „strategischer Organismen“ erkannt und benannt werden.
(3) Dies sensibilisiert für und prägt einen präzisen Sprachgebrauch, vermeidet Missverständnisse und deren Folgen für Organisations-Maßnahmen.
################################
5) Kooperation in der Wirtschaftstheorie von Karl Marx
Karl Marx definierte Kooperation als ökonomische Kategorie und die moderne, industrielle Arbeit als kollektive, d.h. gesellschaftliche Arbeit.
„Die Form der Arbeit vieler, die in demselben Produktionsprozess oder in verschiednen, aber zusammenhängenden Produktionsprozessen planmäßig neben- und miteinander arbeiten, heißt Kooperation.“ (K. Marx, Kapital I. MEW 23, 344f.)
Der (wirtschaftliche) Ertrag ist ein Leistungs-Zuwachs der koordinierten Gemeinschaftsarbeit gegenüber der isolierten individuellen Arbeit.
Industrielle, gesellschaftliche Arbeit verbindet die begrenzten Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse jedes Einzelnen zu bemerkenswerten kollektiven Ergebnissen, die alle Genieleistungen der handwerklichen, individuellen Produktionsweise in den Schatten stellen.
6) Kooperation in der marxistischen Sozialpsychologie
H. Hiebsch & M. Vorwerg (1966) erkannten im konkreten Kooperationsprozeß in der Form funktionsteiliger Abstimmung individueller Aktivitäten für ein gemeinsames Ziel zwei elementare Merkmale des Menschen:
1) der gesellschaftliche (soziale) Charakter des menschlichen Wesens;
2) die Arbeit als wesentliche (schöpferische) Tätigkeit des Menschen.
Die Sozialpsychologie definierte daraus folgende Begrifflichkeit:
- „Soziale Wechselwirkung“ ist das wechselseitige Aufeinandereinwirken von mindestens zwei Individuen während eines beliebigen Aktes der Lebenstätigkeit innerhalb eines gemeinsamen Raum-Zeit-Bezugssystems.
- „Soziale Interaktion“ ist dabei das äußerlich sichtbare aufeinander bezogene Verhalten.
- „Soziale Kommunikation“ ist dabei der aufeinander bezogene Austausch von Informationen.
7) Gruppen-Vorteil durch Kooperation
Kooperation erzeugt in der sozialen Wechselwirkung einen Gruppen-Vorteil durch höheren Nutzen gegenüber dem Nutzen isolierten individuellen Arbeitens:
Kollektive (physische und/oder geistige) Kraft-Potenz ist mehr als die einfache Summe der individuellen Kraftpotenzen.
(1) Faktoren des Leistungsvorteils von Kooperation:
Der Leistungs-Vorteil der Gruppe ergibt sich aus folgenden Prozessen:
- Fehlerausgleich,
- Kräfteausgleich,
- Summation und Synergie der Kräfte
- Erhöhung der individuellen Einsatzbereitschaft (Wetteifern in sozialen Situationen)
(2) Voraussetzung für den kollektiven Leistungsvorteil:
Ist das geordnete und geregelte Zusammen-Wirken der Individuen durch die Koordinierung der Informationen und Kräfte.
(3) Führung der Kooperation:
Deshalb ergibt sich in Kooperationssituationen bewußt oder unbewußt das Bedürfnis nach Regelung des aufeinander bezogenen Verhaltens durch eine Koordinations-Funktion (Führung).
Koordination (Führung als Funktion bzw. Instanz und Leistung) ist in der Kooperation das notwendige, räumlich und zeitlich geplante sowie zielgerichtete Kombinieren (Zusammenbringen, Vereinigen, Ordnen) von
- Objekten (Material, Werkzeuge, Produktionsmittel),
- Akten (gezieltes Anordnen des Verhaltens individueller Qualitäten) und
- Informationen (Wissen, Regeln)
Produktionsmittel sind alle Gegenstände (Objekte) und Bedingungen, die notwendig sind, um Güter zu produzieren. Dazu gehören Gebäude, Maschinen, Werkzeuge, Rohstoffe und Betriebsstoffe. Im Wesentlichen handelt es sich um Arbeits- und Betriebsmittel, die für die wirtschaftliche Produktion essentiell sind.
++++++++++++++++++++
8) Private oder gesellschaftliche Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums?
- Die Art und Weise, wie die arbeitende Bevölkerung bzw. die Produzenten mit den Produktions-Mitteln verbunden sind bzw. wie sie diese einsetzen, hängt von der Eigentumsform ab und unterscheidet verschiedene Produktionsweisen und Gesellschaftsformationen (Kapitalismus, Sozialismus).
- Die durch gesellschaftliche Arbeit (Kooperation in der modernen industriellen Produktion) erzeugten Produkte sind gesellschaftliche Produkte: Das geschaffene „materielle Produkt ist das gemeinsame Produkt dieser Personen oder ihr gemeinsames Produkt ist im materiellen Reichtum vergegenständlicht“ (K. Marx, Theorien über den Mehrwert I., MEW 26.1, 386f.)
Unter kapitalistischen Produktionsbedingungen ist das Produktions-Verhältnis jeder einzelnen dieser kooperierenden Personen ist „das des Lohnarbeiters zum Kapital und in diesem eminenten Sinn das des produktiven Arbeiters. Alle diese Personen sind nicht nur unmittelbar in der Produktion von materiellem Reichtum beschäftigt, sondern sie tauschen ihre Arbeit unmittelbar gegen das Geld als Kapital aus und reproduzieren daher unmittelbar außer ihrem Lohn einen Mehrwert für den Kapitalisten. Ihre Arbeit besteht aus bezahlter Arbeit plus unbezahlter Mehrarbeit.“ (K. Marx, Theorien über den Mehrwert I., MEW 26.1, 386f.)
Siehe: Wal Buchenberg: Kooperation (gesellschaftliche Arbeit), 2002 (https://marx-forum.de/marx-lexikon/lexikon_k/kooperation.html)
9) Idealtypischer Vergleich von Kapitalismus und Sozialismus
- Kapitalismus (Privateigentum an Produktionsmitteln):
Gesellschaftliche Arbeit (Kooperation) und gesellschaftlicher Reichtum unter Kontrolle des privaten Kapitals, der wenigen Ausbeuter und Profiteure.
Ziele: Gewinn-, Kapital-, oder Wachstumsmaximierung.
- Sozialismus (Gesellschaftliches Eigentum an Produktionsmitteln):
Gesellschaftliche Arbeit (Kooperation) und gesellschaftlicher Reichtum unter Kontrolle der Gesellschaft, der meisten werktätigen Menschen.
10) Sozialismus: Gesellschaftliche Produktion und Vermehrung des Volkseigentums und Volksvermögens.
Ich lebte, lernte und arbeitete bis 1990 unter grundsätzlich sozialistischen Gesellschaftsbedingungen.
Deshalb war für mich das gesellschaftliche Eigentum an Produktionsmitteln (Volks-Eigentum), die planmäßige gesellschaftliche Arbeit als Kooperation in der Industrie, in der Volks-Wirtschaft und in der gesamten Gesellschaft (Volks-Republik) für eine gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus sowie zur gesellschaftlichen Aneignung und Nutzung der Produktionsergebnisse völlig plausibel.
Die konkret-historische Umsetzung dieser neuen Möglichkeiten erwies sich zwischen 1949 und 1989 unter den globalen Bedingungen des zerstörten und besetzen Deutschlands, des kalten Krieges mit der unfertigen Theorie von Marx und dem verratenen Praxis-Modell der Sowjetunion als unmöglich. Das sozialistische Gesellschafts-Experiment scheiterte. Die wirklichen Ursachen sind noch neutral und sachlich zu erforschen. Bisher schreiben weiter die Sieger die Geschichte.
Jedenfalls braucht jede Kooperation als notwendige Funktion für die Koordination eine kluge, klare und flexible Führung (als kompetente Persönlichkeiten, wirksame Institution und echte Koordinations-Leistung mit konzeptioneller Wirksamkeit).
11) Kapitalismus: Gesellschaftliche Produktion und Vermehrung des Privateigentums und privaten Reichtums
Ich erlebe heute den realen Kapitalismus als Sozialisierung privater Verluste und Privatisierung gesellschaftlich erzeugter Gewinne.
Unter den Produktionsverhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln basieren, erzeugen lohnabhängige Produzenten (Arbeiterklasse) durch gesellschaftliche Produktion einen materiellen Reichtum, der sich in gesellschaftlichen Produkten manifestiert.
Dieser Reichtum der Gesellschaft wird jedoch durch die Aneignung der unbezahlten Mehrarbeit (Mehrwert) privatisiert und vermehrt ausschließlich den privaten Reichtum der Kapitaleigentümer und Besitzer von Produktionsmitteln, was eine fundamentale Ausbeutung darstellt.
12) Anglo-amerikanischer Kapitalismus
Der American Way of Life ist ein für die Vereinigten Staaten typischer Lebensstil. Zu den Merkmalen der „amerikanischen Lebensart“ gehören
- ein stark ausgeprägter Individualismus,
- individuelle Freiheitsliebe und
- das Streben nach irdischem Glück und (materiellem) Wohlstand.
Die Dominanz des Eigennutzes (Egoismus, extremer Individualismus) in der gesellschaftlichen Ordnung, die als hierarchisches Elite-Masse-System organisiert ist, führt zwangsläufig zu einer (sozialen) Dynamik von Konkurrenz, Kampf, Krieg sowie letztlich zu Versklavung und Ausbeutung. Diese Struktur basiert auf der Herrschaft weniger über viele durch die Kontrolle über Produktionsmittel und Besitz von Ressourcen wie Wissen, Kapital und Macht („Teile und herrsche“).
Sie steht im direkten Gegensatz zu Kooperation, Kollektivität und einem Gemeinwohl orientierten Miteinander.
1. Kooperation versus Konkurrenz: Kooperation betont das gemeinschaftliche Zusammenleben, die solidarische Zusammenarbeit und zielgerichtete Anstrengungen, die allen Beteiligten zugutekommen. Im Gegensatz dazu stehen Konkurrenz und Wettbewerb, die individuelles Streben nach Eigennutz fördern, oft auf Kosten anderer. Konkurrenz orientiert sich am „Wolfsgesetz“, das die Starken bevorzugt und die Schwachen marginalisiert, wodurch soziale Ungleichheit verstärkt wird.
2. Gemeinschaft versus Isolation und Konflikt: Begriffe wie „Isolation“, „Gegnerschaft“, „Konflikt“ oder „Krieg“ beschreiben das Fehlen oder die Zerstörung von Gemeinschaft, gegenseitiger Unterstützung und koordinierten Vereinbarungen. Während Kooperation auf gegenseitiges „Leben und leben lassen“ abzielt, fördern diese Gegenbegriffe Spaltung, Unterdrückung und die Auflösung sozialer Bindungen, was die Grundlage für Ausbeutung und Freiheitsentzug bildet.
3. Ursachen und Konsequenzen: Die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen (z. B. Privateigentum an Produktionsmitteln oder Monopolisierung von Wissen) verstärkt diese Sozial-Dynamiken, indem sie soziale Hierarchien zementiert und Konflikte um begrenzte Ressourcen anheizt. Kooperation hingegen erfordert eine Kultur der Gleichberechtigung, Transparenz und geteilter Verantwortung, um beständige, für alle vorteilhafte Lösungen zu schaffen. Ohne solche Ansätze drohen gesellschaftliche Systeme in einen Kreislauf aus Konkurrenzdruck, Konflikt, Unterdrückung und Ausbeutung zu geraten, der langfristig die soziale Kohäsion und das Wohlergehen aller gefährdet.
4. Erkenntnis: Die Stabilität von Gemeinschaft bzw. Gesellschaft ist ein wesentliches Problem der Kooperation: Ohne einen Grundstock an Kooperatoren und eine regulierte bzw. reglementierte Anzahl von Defektoren ist ein soziales System auf Dauer nicht stabil.
Strategische Organismen wie der Mensch in Gemeinschaft ermöglichen und nutzen Kooperation.
Aber die Stabilität von Gemeinschafts-Systemen (Gesellschaft) erfordert
- sowohl ein Fundament an aktiven Kooperatoren,
- als auch Mechanismen gegen Parasiten oder passive „Trittbrettfahrer“
13) Zusammenarbeit und das Problem des Trittbrettfahrens
- Bestimmte Einzel-Personen („Defektoren“ oder „Free Rider“ in der Spieltheoriem; Kapitalisten, Aktionäre in der liberal-kapitalistischen Ökonomie) wollen von kollektiven Anstrengungen profitieren (parasitieren), ohne selbst einen Beitrag zu leisten. Jemanden, der sich auf den Erfolg oder die Bemühungen anderer verlässt, um eigene Vorteile zu erzielen, ohne die damit verbundenen Aufwände (Kosten) oder Risiken zu tragen. Dies kann sowohl positiv als auch negativ konnotiert sein, je nachdem, ob der Trittbrettfahrer tatsächlich Schaden anrichtet oder einfach nur eine freie Leistung in Anspruch nimmt.
- Kapitalismus = Kooperation systemisch ohne Kontrolle der Parasiten (Ausbeuter und Profiteure).
- Strafmaßnahmen können dabei das Entziehen angenehmer Reize (Nutzen ohne Aufwände) beinhalten und sollen weiteres parasitäres Verhalten verhindern.
14) Kapitalismus = gesellschaftlich erzeugter Reichtum wird privatisiert, private Unternehmens-Verluste werden sozialisiert.
Unter den Produktionsverhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln basieren, erzeugen lohnabhängige Produzenten (Arbeiterklasse) durch gesellschaftliche Produktion einen materiellen Reichtum, der sich in gesellschaftlichen Produkten manifestiert.
Dieser Reichtum der Gesellschaft wird jedoch durch die Aneignung der unbezahlten Mehrarbeit (Mehrwert) privatisiert und vermehrt ausschließlich den privaten Reichtum der Kapitaleigentümer und Besitzer von Produktionsmitteln, was eine fundamentale Ausbeutung darstellt.
15) Der Staat der Kapitalisten
Dreiste Behauptung:
Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) ist ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat, der von den Bürgern durch Wahlen repräsentiert wird.
Teuflische Wahrheit:
Diese Staats-Simulation agiert als Instrument der Kapitalistenklasse, die die Interessen des (globalen) Kapitals schützt und dauerhaft fortsetzt:
- Schaffung und Erhaltung einer bürokratischen Apparatur auf Kosten der Gesellschaft, die Steuern primär von Lohnabhängigen eintreibt, während Kapitaleinkünfte oft steuerlich begünstigt oder umgangen werden. „In Deutschland werden Arbeitseinkommen besonders stark durch Steuern und Sozialabgaben belastet. Laut einer Studie der Industrieländerorganisation OECD liegt Deutschland auf Platz zwei von 38 untersuchten Staaten. Nur in Belgien muss ein Durchschnittsverdiener noch höhere Steuern und Sozialabgaben zahlen als hierzulande.“ (Handelsblatt, 26.04.2024)
- Übergabe gesellschaftlicher Steuergelder als Subventionen und Förderungen in private Unternehmen (2024 über 1.350 Förderprogramme für Unternehmen), um deren Profitabilität zu sichern.
- Rettung und Sanierung bankrotter, „systemrelevante“ Privat-Unternehmen (z. B. Banken oder Konzerne; ökonomische Kriterien: Grösse und Marktkonzentration, Vernetzungsgrad und mangelnde Substituierbarkeit) mit öffentlichen Mitteln (Steuergelder der Gesellschaft), wodurch private Verluste sozialisiert, aber Gewinne privatisiert bleiben und die Renditen für Aktionäre und Eigentümer gewahrt werden.
- Verwendung von Steuergeldern für Kriegszwecke. Dies geschieht sowohl direkt durch die Finanzierung von militärischen Ausgaben als auch indirekt durch die Bekämpfung von Steuerflucht, welche die Verfügbarkeit von Mitteln für Kriege beeinträchtigen kann. Historisch gab es spezifische Steuern zur Finanzierung von Kriegen, wie die Kriegsabgabe. Öffentliche Steuergelder finanzieren Rüstung und Kriege, in denen vor allem Lohnabhängige als Soldaten oder Zivilisten getötet werden, während Kapitalinteressen (z. B. Maximal-Profite, Ressourcensicherung) profitieren.
- Massen-Migration aus Regionen wie Nahost oder Afrika kostet den Steuerzahler viel Geld. „Im Jahr 2025 betrug der Anteil der ausländischen Leistungsempfänger von Bürgergeld in Deutschland bis Februar durchschnittlich rund 47,2 Prozent.“ Ein Asylwerber aus Afrika kostet dem Steuerzahler (niederländische Studie) im Laufe seines Lebens 625.000 Euro. Ökonomen Bernd Raffelhüschen (Uni Freiburg): „Die Zuwanderung, wie sie bisher geschieht, kostet uns gesamtwirtschaftlich 5,8 Billionen Euro.“
- „Sozialstaat nicht mehr finanzierbar“ – Friedrich Merz (BRD-Kanzler seit 2025) will grundlegende Reformen.
- NGOs und Stiftungen werden mit öffentlichen Steuergelder finanziert, die Ideologien oder Ziele vertreten, die nicht im Interesse der steuerzahlenden Menschen sind („US-amerikanische Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen“ wie Open Society Foundations, Atlantic Council, Aspen Institute, Bill & Melinda Gates Foundation.) https://dserver.bundestag.de/btd/21/010/2101070.pdf
- Offizielle Staats-Verschuldung von 2,6 Billionen Euro (2025) bei einer Neuverschuldung im Jahr 2025 von 82 Milliarden Euro. Als Hauptgründe gelten die Folgen der (politische inszenierten) Pandemie, kostspielige „Sondervermögen“ für die Aufrüstung und künftig für die Infrastruktur sowie eine Außerkraftsetzung der „Schuldenbremse“ für Kriegsausgaben ab 2025. (https://www.steuerzahler.de)
- Steuerverschwendung der Regierung: Das jährliche „Schwarzbuch“ der öffentlichen Steuerverschwendung beweist, daß die Politik in der BRD Milliarden Euro Steuergelder in sinnlose Projekte steckt.
- Während in der BRD das Sozialsystem aufgrund der monumentalen Kosten für unbegrenzt einwandernde Geldempfänger zusammenbricht, werden 2025 für das Kiew-Regime unter Selensky die Hähne für schier unbegrenzte Geldströme geöffnet: Jährlich neun Milliarden Euro sollen aus Deutschland in die Ukraine fließen.
- Für den Staatshaushalt wurden unvorstellbare 1 Billion Euro Schulden aufgenommen und zusätzlich will man Steuererhöhungen durchsetzen.
„Während Sie auf kaputten Straßen und einsturzgefährdeten Brücken fahren müssen, Ihre Kinder in Klassenzimmern sitzen, die aussehen wie in Ruanda und Sie im Schnitt 9 Monate auf einen Facharzttermin warten, leitet die Regierung einen gigantischen Teil Ihres Steuergelds auf Nimmerwiedersehen in unbekannte, dunkle Kanäle eines Landes, das im Korruptionsindex den Spitzenplatz belegt. Diese Zusammenhänge werden Sie in den regierungshörigen Mainstreammedien nicht finden. Dabei stehen sie so klar vor Augen wie das Wasser eines Bergsees. “ (Freie Welt SvenvonStorch@freiewelt.net, 29.08.2025 )
Wer besitzt und hat Macht auf den Staat?
Kreditgeber haben durch ihre Rolle bei der Staatsfinanzierung erheblichen Einfluss auf den Staat,
- da die Staatsverschuldung oft aus der Ausgabe von Staatsanleihen an private Anleger, Banken und Fonds besteht, welche dann Zinsen vom Staat verlangen und somit die Fiskalpolitik beeinflussen können. Zentralbanken spielen eine besondere Rolle als Kreditgeber letzter Instanz und können durch die Bereitstellung von Liquidität und den Ankauf von Staatsanleihen den Markt stabilisieren.
- Kreditgeber, wie Zentralbanken, haben eine wichtige Rolle gegenüber dem Staat. Sie können Geschäftsbanken finanzieren, selbst wenn andere Anleger dies nicht tun.
- Der Staat selbst nimmt Kredite auf, beispielsweise durch den Verkauf von Staatsanleihen.
- Der Staat hat jedoch auch die Macht, durch das Gewaltmonopol Steuern einzutreiben, was ihn in eine besondere Position gegenüber seinen Gläubigern versetzt.
Die BRD hat Schulden in nie zu tilgender Billionen-Höhe im In- und Ausland und ist dadurch von diesen Schuldnern abhängig, nicht souverän:
- Wer sind die Kreditgeber des deutschen Staates?: „Gläubiger deutscher Staatsschulden – Einblicke in eine Blackbox“
- Im Inland schuldet die BRD Banken, Versicherungen, Investmentfonds oder Privatanlegern Gelder.
- Im Ausland (etwa 47 %) sind folgende Länder Gläubiger der BRD: Niederlande, Luxemburg, Großbritannien, USA, Frankreich, Schweiz, Irland, Japan, Italien, Belgien
Finanz und Steuerpolitik im Interesse der kapitalistischen Herrscherklasse
- Diese zielgerichtete (nicht „strategielose“!) Finanzpolitik im Interesse der kapitalistischen Herrscherklasse,
- der skandalöse Einsatz von Steuergeldern der deutschen Gesellschaft („Steuerzahler“) sowie
- die Aufnahme von riesigen Schuldenbergen durch die Regierenden
kann der Bürger zwar wissen (Bund der Steuerzahler e.V. mit Deutsches Steuerzahlerinstitut bei völliger Intransparenz der Regierung), Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin wollen und fordern, aber nicht beeinflussen. Dem Bürger bleiben 2025 von 1 Euro Einkommen noch 47 Cent verfügbar.
KRAUTZONE-Berechnung („Dunkeldeutschland“, Krautzone,40. Ausgabe, August/September 2024, S. 30)
Bezieht man alle Faktoren (auch Inflation bei Urlaub, Bauen und Wohnen, Autofahren, Nahrungsmittel u.a.) „in eine vorsichtige Schätzung mit ein, kann gut und
gerne davon ausgegangen werden, dass der Durchschnittsbürger in Deutschland rund 80 Prozent direkte und indirekte Abgaben zahlt.“
Lebensqualitätsminimum: Was Menschen zum Leben brauchen
Das überparteiliche Denk-Unternehmen „Dezernat Zukunft“ ermittelte 2025 Maßstäbe dafür, „was Menschen für ein angemessenes Leben brauchen“. Das Lebensqualitätsminimum (LQM) bietet eine neue, bürgernahe Referenzgröße – nicht zur Änderung der ungerechten Gesellschaft, sondern, „um den Armuts- und Reichtumsbericht weiterzuentwickeln“.
Im Ergebnis zeigte sich, „dass der Status Quo vielfach das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletzt. Besonders den Wunsch nach gesellschaftlicher Teilhabe und einem nachhaltigen Leben ist für die gesellschaftliche Mitte nicht vollständig einlösbar.“ (https://dezernatzukunft.org/lebensqualitaetsminimum-was-menschen-zum-leben-brauchen)
+++++++++++++
Zwang zur Konkurrenz im Kapitalismus
Der Zwang zur Konkurrenz unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen ergibt sich aus der Struktur des Kapitalismus, die auf Privateigentum an Produktionsmitteln, der Profitmaximierung und der Marktlogik basiert. Im Folgenden wird der Mechanismus präzise und systematisch erklärt:
1. Privateigentum an Produktionsmitteln
Im Kapitalismus gehören die Produktionsmittel (Fabriken, Maschinen, Rohstoffe) privaten Kapitaleigentümern, nicht den Produzenten (Arbeitern). Diese Eigentümer entscheiden über Produktion und Verteilung, mit dem Ziel, ihren privaten Reichtum durch Profit zu vermehren. Lohnabhängige, die keine Produktionsmittel besitzen, sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben. Diese Abhängigkeit schafft eine grundlegende Ungleichheit, die den Wettbewerb antreibt, da Arbeiter und Unternehmen um begrenzte Ressourcen (Arbeitsplätze, Marktanteile) konkurrieren müssen.
2. Profitmaximierung als treibende Kraft
Die Logik des Kapitalismus zwingt Unternehmen, ihren Profit zu maximieren, um zu überleben. Unternehmen stehen in ständiger Konkurrenz, da sie um Marktanteile, Kunden und Investitionen kämpfen. Wer nicht wettbewerbsfähig bleibt (z. B. durch Kostensenkung, Innovation oder Marktbeherrschung), riskiert, vom Markt verdrängt zu werden. Dies führt zu einem ständigen Druck, effizienter, billiger oder innovativer zu produzieren, was die Konkurrenz zwischen Unternehmen verschärft.
3. Konkurrenz zwischen Kapitalisten
Kapitalisten konkurrieren untereinander, um ihre Produkte zu verkaufen und ihre Kapitalakkumulation zu sichern. Dies zeigt sich in:
- Preiswettbewerb: Unternehmen senken Preise, um Kunden zu gewinnen, was oft zu Kostensenkungen (z. B. bei Löhnen oder Qualität) führt.
- Innovation: Um sich abzuheben, investieren Unternehmen in neue Technologien oder Produkte, was wiederum den Druck auf andere erhöht, nachzuziehen.
- Marktanteile: Größere Unternehmen versuchen, kleinere zu verdrängen oder zu übernehmen, was zu Monopolisierungstendenzen führt, die jedoch den Wettbewerb nicht aufheben, sondern verschärfen.
4. Konkurrenz unter Lohnabhängigen
Lohnabhängige stehen ebenfalls in Konkurrenz, da sie um begrenzte Arbeitsplätze, bessere Löhne oder Aufstiegschancen kämpfen. Der Arbeitsmarkt funktioniert nach Angebot und Nachfrage: Ein Überschuss an Arbeitskräften („industrielle Reservearmee“) drückt die Löhne und zwingt Arbeiter, sich durch höhere Leistung, Flexibilität oder Qualifikation von anderen abzuheben. Dieser Wettbewerb schwächt die Verhandlungsposition der Arbeiter und stärkt die der Kapitalisten.
5. Systemischer Zwang durch Marktlogik
Der Markt zwingt alle Akteure – Kapitalisten wie Lohnabhängige – in die Konkurrenz, da das Überleben von der Fähigkeit abhängt, sich im Wettbewerb zu behaupten. Unternehmen müssen Gewinne erzielen, um zu reinvestieren; Arbeiter müssen Jobs sichern, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Dieser Zwang ist nicht individuell gewollt, sondern systemisch: Selbst wohlmeinende Unternehmer oder kooperative Arbeiter können sich der Logik nicht entziehen, da sie sonst wirtschaftlich scheitern.
6. Auswirkungen der Konkurrenz
- Ausbeutung: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, maximieren Unternehmen die Mehrarbeit (unbezahlte Arbeitszeit), was die Ausbeutung der Lohnabhängigen verstärkt.
- Ungleichheit: Konkurrenz führt zu einer Konzentration von Reichtum bei wenigen (Kapitalakkumulation), während Lohnabhängige in prekären Verhältnissen bleiben.
- Instabilität: Der ständige Wettbewerb erzeugt Krisen (Überproduktion, Marktsättigung), die Arbeitslosigkeit und soziale Spannungen fördern.
- Antagonismus statt Kooperation: Die Konkurrenz verhindert kollektive Lösungen, da individuelle oder unternehmerische Interessen priorisiert werden, was Kooperation und Gemeinwohl untergräbt.
Fazit
- Der Zwang zur Konkurrenz im Kapitalismus resultiert aus der strukturellen Abhängigkeit von Privateigentum, Profitmaximierung und Marktlogik.
- Diese zwingt sowohl Kapitalisten als auch Lohnabhängige in einen Wettbewerb um Ressourcen, Marktanteile und Überleben, was Ausbeutung, soziale Ungleichheit und soziale Spannungen verstärkt.
- Kooperation wird durch diese Dynamik systematisch erschwert, da sie dem Primat des Eigennutzes und der Konkurrenz entgegensteht.
++++
Individueller Eigennutz
Die Dominanz des Eigennutzes (Egoismus, extremer Individualismus) in der gesellschaftlichen Ordnung, die als hierarchisches Elite-Masse-System organisiert ist, führt zwangsläufig zu einer (sozialen) Dynamik von Konkurrenz, Kampf, Krieg sowie letztlich zu Versklavung und Ausbeutung. Diese Struktur basiert auf der Herrschaft weniger über viele durch die Kontrolle über Produktionsmittel und Besitz von Ressourcen wie Wissen, Kapital und Macht („Teile und herrsche“).
Sie steht im direkten Gegensatz zu Kooperation, Kollektivität und einem Gemeinwohl orientierten Miteinander.
1. Kooperation versus Konkurrenz: Kooperation betont das gemeinschaftliche Zusammenleben, die solidarische Zusammenarbeit und zielgerichtete Anstrengungen, die allen Beteiligten zugutekommen. Im Gegensatz dazu stehen Konkurrenz und Wettbewerb, die individuelles Streben nach Eigennutz fördern, oft auf Kosten anderer. Konkurrenz orientiert sich am „Wolfsgesetz“, das die Starken bevorzugt und die Schwachen marginalisiert, wodurch soziale Ungleichheit verstärkt wird.
2. Gemeinschaft versus Isolation und Konflikt: Begriffe wie „Isolation“, „Gegnerschaft“, „Konflikt“ oder „Krieg“ beschreiben das Fehlen oder die Zerstörung von Gemeinschaft, gegenseitiger Unterstützung und koordinierten Vereinbarungen. Während Kooperation auf gegenseitiges „Leben und leben lassen“ abzielt, fördern diese Gegenbegriffe Spaltung, Unterdrückung und die Auflösung sozialer Bindungen, was die Grundlage für Ausbeutung und Freiheitsentzug bildet.
3. Ursachen und Konsequenzen: Die ungleiche Verteilung von Macht und Ressourcen (z. B. Privateigentum an Produktionsmitteln oder Monopolisierung von Wissen) verstärkt diese Sozial-Dynamiken, indem sie soziale Hierarchien zementiert und Konflikte um begrenzte Ressourcen anheizt. Kooperation hingegen erfordert eine Kultur der Gleichberechtigung, Transparenz und geteilter Verantwortung, um beständige, für alle vorteilhafte Lösungen zu schaffen. Ohne solche Ansätze drohen gesellschaftliche Systeme in einen Kreislauf aus Konkurrenzdruck, Konflikt, Unterdrückung und Ausbeutung zu geraten, der langfristig die soziale Kohäsion und das Wohlergehen aller gefährdet.
4. Erkenntnis: Die Stabilität von Gemeinschaft bzw. Gesellschaft ist ein wesentliches Problem der Kooperation: Ohne einen Grundstock an Kooperatoren und eine regulierte bzw. reglementierte Anzahl von Defektoren ist ein soziales System auf Dauer nicht stabil.
Strategische Organismen wie der Mensch in Gemeinschaft ermöglichen und nutzen Kooperation.
Aber die Stabilität von Gemeinschafts-Systemen (Gesellschaft) erfordert
- sowohl ein Fundament an aktiven Kooperatoren,
- als auch Mechanismen gegen Parasiten oder passive „Trittbrettfahrer“
Zusammenarbeit und das Problem des Trittbrettfahrens
- Bestimmte Einzel-Personen („Defektoren“ oder „Free Rider“ in der Spieltheoriem; Kapitalisten, Aktionäre in der liberal-kapitalistischen Ökonomie) wollen von kollektiven Anstrengungen profitieren (parasitieren), ohne selbst einen Beitrag zu leisten. Jemanden, der sich auf den Erfolg oder die Bemühungen anderer verlässt, um eigene Vorteile zu erzielen, ohne die damit verbundenen Aufwände (Kosten) oder Risiken zu tragen. Dies kann sowohl positiv als auch negativ konnotiert sein, je nachdem, ob der Trittbrettfahrer tatsächlich Schaden anrichtet oder einfach nur eine freie Leistung in Anspruch nimmt.
- Kapitalismus = Kooperation systemisch ohne Kontrolle der Parasiten (Ausbeuter und Profiteure).
- Strafmaßnahmen können dabei das Entziehen angenehmer Reize (Nutzen ohne Aufwände) beinhalten und sollen weiteres parasitäres Verhalten verhindern.
Kapitalismus = gesellschaftlich erzeugter Reichtum wird privatisiert, private Unternehmens-Verluste werden sozialisiert.
Unter den Produktionsverhältnissen der kapitalistischen Gesellschaft, die auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln basieren, erzeugen lohnabhängige Produzenten (Arbeiterklasse) durch gesellschaftliche Produktion einen materiellen Reichtum, der sich in gesellschaftlichen Produkten manifestiert.
Dieser Reichtum der Gesellschaft wird jedoch durch die Aneignung der unbezahlten Mehrarbeit (Mehrwert) privatisiert und vermehrt ausschließlich den privaten Reichtum der Kapitaleigentümer und Besitzer von Produktionsmitteln, was eine fundamentale Ausbeutung darstellt.
Lösung?
- Grunderkenntnis: Erneut bestätig der amerikanische Entwicklungspsychologen und Anthropologen Michael Tomasello in Untersuchungen eindrucksvoll, dass der Mensch bereits in den ersten Lebensjahren eine angeborene Neigung zum kooperativen Handeln besitzt. Diese Fähigkeit tritt jedoch durch den existentiellen Überlebenskampf in der kapitalistischen Gesellschaft und die darin wirkende Erziehung bzw. Manipulation in den Hintergrund.
- Interdisziplinäre Ansätze (Philosophie, Soziologie, Psychologie, Biologie) könnten mit Systemtheorie (Kybernetik) fruchtbare Lösungen finden für die Stabilität und die langfristige Erhaltung von Kooperation sowie der Kontrolle von deren (parasitärer) Ausnutzung.
Bild von <Sd1> Gerd Altmann von <Sd2> pixabay


